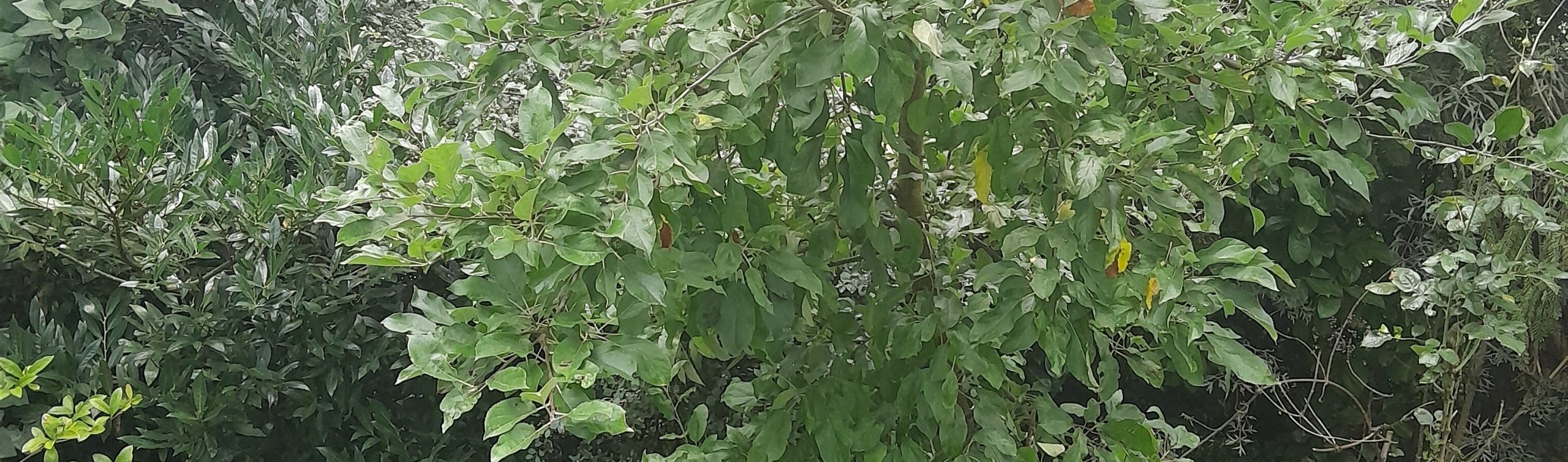Auch am Karfreitag 2024 geht es wieder um die Frage, ob die Gesellschaft ihren Unterhaltungsbetrieben den Betrieb an solchen Tagen untersagen darf, wenn diese als „stille“ Feiertage mit einem Tanzverbot belegt sind. Und es geht um die Frage, ob diese Charakterisierung eines Feiertags als „stiller“ Feiertag mit Bezug auf eine einzelne Religion, das Christentum, begründet werden darf.
Tatsächlich geht es also um zwei Fragen.
Ich halte die zweite Frage einfacher zu beantworten, deswegen fange ich hier an. Eine Gesellschaft, die christliche Feiertage zu gesetzlichen Feiertagen macht, sollte dabei auch den religiösen Bezug und Charakter dieser Feiertage übernehmen. Unsere Gesellschaft hat zahlreiche christliche Feiertage zu gesetzlichen Feiertagen gemacht, außer Karfreitag auch Dreikönigstag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Reformationstag, Allerheiligen, Buß- und Bettag, Erster Weihnachtsfeiertag, Zweiter Weihnachtsfeiertag. Damit macht sie sich auch diesen religiösen Bezug zu eigen. Weil Christ*innen den Karfreitag eher als Fast-, Trauer- und Gedenktag begehen, ist also ein Tanzverbot angemessen.
Selbstverständlich muss eine säkulare Gesellschaft die religiösen Feiertage aber nicht zu gesetzlichen Feiertagen machen. Sie kann sogar solche gesetzlichen Feiertage wieder abschaffen, wie man alte Zöpfe abschneidet. Konsequenterweise sollte sie das tun, wenn sie sich von religiösem Einfluss frei machen will. Eine säkulare Gesellschaft kann auf die christlichen Feiertage Dreikönigstag, Karfreitag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Fronleichnam, Mariä Himmelfahrt, Reformationstag, Allerheiligen, Buß- und Bettag, Erster Weihnachtsfeiertag, Zweiter Weihnachtsfeiertag verzichten, wenn sie das will. Dann dürfen Clubs am Karfreitag Tanz anbieten, und Supermärkte dürfen am Ostermontag Kartoffeln verkaufen.
Keinesfalls aber sollte eine säkulare Gesellschaft religiöse Feiertage selektiv zu gesetzlichen Feiertagen machen. Als religiöser Mensch will der Verfasser es nicht hinnehmen, dass diese Gesellschaft, in der er lebt, das Kar- und Osternarrativ der Christ*innen willkürlich in einen erwünschten und einen unerwünschten Teil aufbricht. („Erwünscht“ wäre der gesetzliche Feiertag, „unerwünscht“ wäre das mit dem religiösen Bezug verbundene Tanzverbot.) Karfreitag und Ostern gehören im christlichen Glauben untrennbar zusammen. Eine willkürliche gesetzliche Trennung durch eine säkulare Gesellschaft müssten gläubige Menschen als Missachtung ihrer Religion (und damit auch ihrer Religionsfreiheit) verstehen.
Pointiert ausgedrückt: eine Gesellschaft, die sich gegen ein Tanzverbot am Karfreitag entscheidet, sollte sich gegen alle gesetzlichen Feiertage mit religiösem Bezug entscheiden. Mit dem Tanzverbot am Karfreitag sollte sie die gesetzlichen Feiertage mit religiösem Bezug abschaffen.
Allerdings könnte die Gesellschaft weitere säkulare Feiertage einführen. Man muss ja irgendwie die Lücke füllen, um sich seelisch zu erheben oder tanzen gehen zu können. Hier ein paar Vorschläge: Holocaust-Gedenktag (27.01.), Frauentag (08.03.), Tag der Befreiung vom Nationalsozialismus (08.05.), Verfassungstag (23.05.), Friedensfest (08.08.), Weltkindertag (20.09.). Sie müssen aber den Charakter der „seelischen Erhebung“ erhalten, dies gilt unabhängig von einem religiösen Bezug. Einige dieser Vorschläge sind ja bereits als regionale gesetzliche Feiertage eingerichtet.
Angenommen, die säkulare Gesellschaft in Deutschland würde den 27.Januar als gesetzlichen Feiertag zum „Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus“ einrichten. Wäre an einem solchen Tag ein Tanzverbot angemessen? Es wäre ja kein religiöser Bezug. Aber es wäre ein gesamtgesellschaftliches Bekenntnis gegen staatlich organisierten Völkermord und für demokratisch verankerten Minderheitenschutz.
Ich finde die Frage vielschichtig — zu komplex für einen Kurzbeitrag zur Karfreitags-Debatte. Vielleicht ein andermal mehr dazu.